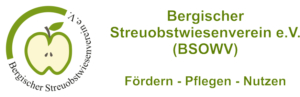Ein Auszug von Hans-Joachim Bannier aus seinem Newsletter “Alte Obstsorten” vom Oktober 2023
Birnen müssen grundsätzlich hartreif geerntet werden.
“Pflückreif” sind sie, wenn der Stiel beim Hochkippen der Frucht locker vom Zweig löst. Anschließend werden sie erst nach einer gewissen Lagerzeit (die je nach Sorte eine Woche oder auch 3 Monate betragen kann!) schmelzend weich und saftig. Wann sie dann ihre Genussreife erreichen, erkennt man entweder daran, dass sie weicher werden oder auch am Aufhellen ihrer Farbe (z.B. von grün auf gelb oder – bei den “grauen” Sorten – von graubraun/graugrün auf hell bronzefarben). Lässt man die Früchte zu lange am Baum hängen (bis ihre grüne Fruchtfarbe am Baum auf gelb umschlägt und sie “reif” aussehen), sind sie – bei den meisten Sorten – saftarm, mehlig und ungenießbar.
Im hartreifen (“pflückreifen”) Zustand schmecken die meisten Birnen noch roh, trocken und wenig aromatisch. Nur bei den wenigsten Sorten sind die Früchte auch hartreif bereits ausreichend aromatisch und wohlschmeckend zum Frischverzehr (z.B. bei ‘Bosc’s Flaschenbirne’, ‘Herrenhäuser Winterchristenbirne’ oder der Sorte ‘Tongern’), so dass sie je nach persönlicher Vorliebe hartreif oder schmelzend saftig genossen werden können.
Lagerung und Nachreifung von Birnen
Auch im Obst-Arboretum Olderdissen verkaufen wir im Hofladen manche Birnensorten (wie z.B. aktuell die ‘Köstliche von Charneux’ oder die ‘Conference’) auch schon im hartreifen Zustand. Je nachdem, bei welcher Temperatur sie anschließend gelagert werden (im warmen Zimmer oder im Kühlschrank), erfolgt die Nachreife (d.h. das Umfärben und Weichwerden der Frucht) dann schneller oder langsamer.
Etwas “zu früh” geerntete Früchte brauchen in der Regel ein bisschen länger zum Nachreifen als die Früchte, die eher etwas spät vom Baum genommen wurden. Durch eine folgernde Ernte – d.h. ein mehrmaliges Durchpflücken – lässt sich jedoch die Genusszeitraum der Früchte eines Birnbaums deutlich verlängern.
Ernte von Birnen zur Saftherstellung
Sollen Birnen zur Saftbereitung verarbeitet werden, müssen sie ebenfalls bei Pflückreife, d.h. hartreif, geerntet bzw. geschüttelt werden. Gelb und weich gewordene Früchte liefern nicht nur weniger Saft, sondern können auch (bei zu großer Menge) die Presstücher in der Mosterei ‘verstopfen’.
Herbert Petzold
1950 übernahm Herbert Petzold eine Lehrtätigkeit an Landwirtschaftsschule in Wurzen, die sich mit seiner Unterstützung zu einer Spezialschule für Obstbau entwickelte. Ab 1955 war Petzold maßgeblich an der Anlage von Versuchspflanzungen und Sichtungsgärten beteiligt.
Von 1973 an widmete er sich verstärkt der Veröffentlichung seines umfangreichen Wissens. Sein 1982 erschienenes Fachbuch „Birnensorten” etablierte sich als pomologisches Standardwerk. Für seine Verdienste wurde Petzold als Ehrenmitglied im Pomologen-Verein geehrt.
Die hier vorliegende Auswahl der Birnensorten orientiert sich weitgehend an den in Petzolds Buch beschriebenen Sorten.
Weitere Literatur
Die Sortenbeschreibungen auf dieser Internetseite wurden teilweise durch Einfügungen ergänzt, und zwar aus den Werken von
- Kessler, „Birnensorten der Schweiz“,
- Hartmann/Fritz, „Farbatlas Alte Obstsorten“,
- Bannier, u.a., „Lokale und regionale Obstsorten im Rheinland – neu entdeckt“,
- Lauche, “Deutsche Pomologie”,
- Grill/Keppel, “Alte Apfel- und Birnensorten für den Streuobstbau”,
- Bernkopf, “300 Obstsorten, ein Streifzug durch die oberösterreichische Obstbaumvielfalt”,
- Silbereisen/Götz/Hartmann, “Obstsortenatlas”
- sowie die „Obstsortenempfehlungen für Streuobst“ des Koordinierungsausschuss Obstwiesenschutz NRW
Es wurden noch einige zusätzliche interessante Sorten mit beschrieben, wie z.B. Abate Fetel und regionale Sorten des Bergischen Landes, die von Bannier u.a. in dem Werk „Lokale und regionale Obstsorten im Rheinland“ beschrieben wurden.